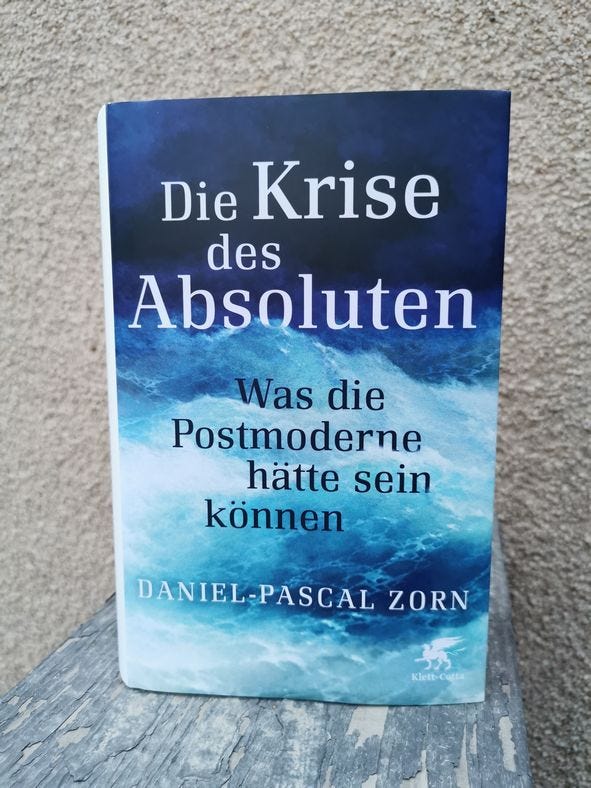Der Philosoph Daniel-Pascal Zorn versucht in „Die Krise des Absoluten – Was die Postmoderne hätte sein können“ die Quadratur des Kreises, nämlich: einerseits eine Darstellung der Postmoderne als Ganzes zu vermeiden, weil dies ein „unmögliches Unterfangen“ sei – und sie andererseits (trotz der bewussten Vorläufigkeit seines Erklärungsversuchs) vor einer allzu oberflächlichen Kritik in Schutz zu nehmen.
Diese Kritik benennt er gleich auf der ersten Seite seines Buches: „Die Postmoderne ist der Ausgangspunkt für die Übel unserer Zeit, für die vier apokalyptischen Reiter Konstruktivismus, Relativismus, Moralismus und Identitätspolitik.“ (9) Ein spannender Einstieg, um den Leser des Jahres 2022 von dort abzuholen, wohin er sich aus Sicht des Autors verirrt hat, nämlich in ein fundamentales Un- und Missverständnis gegenüber der Komplexität von Ideen, deren Kritiker „Sinn, Vereinnahmung, Vorurteil und Polemik Schicht um Schicht auf die Texte, die Personen und ihr Denken“ legen. (16)
Aus seiner Sicht ist die Postmoderne dagegen ein Zeitraum, eine „einzigartige Liaison“, eine Denkbewegung, eine ideengeschichtliche Epoche – aber eben „kein Sammelbegriff für irgendwelche durchgeknallten französischen Philosophen und auch kein Werturteil über den allgemeinen Sittenverfall“. (14)
Zorn schlägt deshalb vor, ihn auf einem „Rundweg durchs philosophische Gebirge“ (46) zu begleiten, damit „im Zusammenschauen, Zusammensehen einiger weniger Aspekte dieser an Aspekten so reichen Theorielandschaft … so eine Ahnung dessen entstehen [könnte], was Postmoderne hätte sein können.“ (17) Mit diesem tiefergelegten Anspruch kann er dann natürlich auch etwas in die Breite gehen, indem er den Kreis der üblichen Verdächtigen (Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze und Jean-François Lyotard) um weitere Protagonisten erweitert, nämlich Joachim Ritter, Theodor W. Adorno, Richard Rorty und Heinz von Foerster. Im Verlauf des Buches arbeitet er die philosophische Vorgeschichte und den gesellschaftlichen Kontext von „fünf Denkrichtungen“ heraus, mit den Etiketten „Poststrukturalismus“, „Frankfurter Schule“, „Ritter-Schule“, „Neuer Pragmatismus“ und „Kybernetik“ oder „Konstruktivismus“. (Ich weiß, das sind sechs, aber das ist Zorns Aufzählung, nicht meine.) Allesamt seien sie Erben der „Frage nach einer Alternative zu dem, was mit der Französischen Revolution und der Überwindung des Absolutismus erledigt schien: das Absolute.“ (48)
Aus diesem Ansatz kuratiert Zorn ein unübersichtliches Sammelsurium von Anekdoten aus dem Leben der genannten Denker, Erläuterungen des gesellschaftlichen und politischen Kontextes zur Zeit der Entstehung der Werke sowie Erklärungen zur Genese bestimmter philosophischer Ideen (mit Rückgriff auf Hume, Hegel, Husserl, Heidegger, Habermas und auf ganz viele andere berühmte Philosophen, die nicht zufällig mit H anfangen). Zorn überlässt es bewusst dem Leser, aus diesen vielen, bunten Mosaiksteinchen ein Gesamtbild (und auf Basis dessen möglicherweise sogar ein Urteil) zu formen.
Eines merkt man jedoch bei der Lektüre: der Autor mag – genauso wie seine Helden – keine Geschichtsphilosophie. Er wehrt sich gegen Metanarrative, also einordnende Großerzählungen wie „geschichtlicher Fortschritt“, „historischer Materialismus“ oder einen dialektisch sich entwickelnden Weltgeist, die für postmoderne Denker das zentrale Manko der Moderne darstellen. Das ist auch der Grund dafür, dass er die Postmoderne nicht positiv beschreiben will und kann, sondern eben nur in Abgrenzung und in ihrer Abwehrhaltung zum „Absoluten“. Dieses lässt er in den Gestalten von Ayatollah Khomeini und Margaret Thatcher mit ihren erfolgreichen Verabsolutierungen von Religion und Markt wiederauferstehen – und markiert damit das Ende des Abwehrkampfes im Jahr 1979.
Auf den letzten Seiten seines Buches wagt sich Zorn dann doch noch an eine zusammenfassende Beurteilung dieser Epoche – wenn auch nur im Spiegel der Wiedergabe von Grundgedanken zweier Werke, die dies vor ihm versucht haben (und die zufälligerweise ebenfalls im Jahr 1979 erschienen sind). Zum einen „Das postmoderne Wissen“, in der Lyotard den Konflikt zwischen Wissenschaft und den Erzählungen inszeniert und dabei ironischerweise selbst eine Metaerzählung produziert (555ff). Danach sei die Pluralität postmodernen Denkens als Relativismus missverstanden worden. Zum anderen Richard Rortys „Der Spiegel der Natur“, aus dem Zorn die Unterscheidung übernimmt zwischen dem Hauptstrom der „systematischen“ Philosophie, die mit geradezu messianischem Sendungsbewusstsein Rationalität und Objektivität propagiert, und „bildender“ (sprich: postmoderner) Philosophen, die das „mahnende und zweifelnde Gedächtnis der Philosophie“ (562) darstellen, die sich weigern mitzuspielen und als notwendiger Störfaktor Sand im Getriebe der „Tauschbeziehungen von Theorien“ sind.
Nur: Ideen haben Konsequenzen, und zwar auch in der nichtakademischen Welt. Daher müssen sie sich gefallen lassen, nach ihren Ursprüngen befragt, einsortiert und beurteilt zu werden. Dazu müsste man den heimeligen Elfenbeinturm der universitären Philosophie nicht einmal verlassen – es würde schon reichen, probehalber eine soziologische oder gar politologische Perspektive einzunehmen.
Eine zusammenfassende Betrachtung der Postmoderne kann sich zwar mit einem differenzierenden Ansatz begnügen und sich jeglicher vorläufigen oder gar abschließenden Bewertung enthalten, so wie Zorn es tut – und sei es aus der lobenswerten Motivation akademischer Redlichkeit heraus. Dann aber bleibt sie für die aktuelle ideengeschichtliche Auseinandersetzung irrelevant.
Oder sie kann meinetwegen ruhig differenzieren, aber dann auch den nächsten Schritt machen und klar Stellung beziehen – das müsste dann aber mehr sein als das verschwurbelte „was die Postmoderne hätte sein können“, mit dem der Autor vermeidet, ein angreifbares Urteil abzugeben. Und müsste dann auch über kurze Bemerkungen wie „Die postmoderne Kritik an der Verabsolutierung des Subjekts wird zur ‚Vernichtung der Subjektivität‘ verdreht“ (542 f.) hinausgehen.
Genug Ansätze sind dazu im Buch vorhanden, denn im letzten Kapitel referiert Zorn eine erste ernsthafte Kritik am postmodernen Denken, die allerdings schon Anfang der Achtziger geübt wird, durch Habermas in Deutschland und durch Glucksmann, Ferry und Renaut in Frankreich (538ff) – eine Kritik, die Zorn als „außerordentlich erfolgreich“ (543) bezeichnet, auch wenn sie „an die Stelle der Texte eine enttäuschte und polemische Rezeption ebendieser Texte“ setze (543). Dabei ist Zorns Beschreibung der Mechanismen dieser Kritik durchaus erhellend: wo Theorie zum Produkt wird, das sich am Markt der ständig wechselnden Aufmerksamkeiten behaupten muss, sind Verkürzungen gang und gäbe, denn „der Markt fordert handhabbares Denken, echte Menschen, nicht dürre Gedankengebäude, die sich nicht verkaufen.“ (549)
Ironischerweise sagt das jemand, der die Metapher des „Gedankengebäudes“ als externe Zuschreibung für philosophische Ideen rigoros ablehnt, wie Zorn in einem hörenswerten Streitgespräch (vom 6.6.2022) im Deutschlandfunk bekundet. Ich würde aber vermeiden, ihn auf solche Unstimmigkeiten anzusprechen, da er kritischen Nachfragen in der Regel mit herablassender Belehrung und eskalierenden Beschimpfungen begegnet, zumindest auf seinem Twitter-Kanal. Ob sich darin nur die professionelle Ungeduld eines einzigartigen Experten ausdrückt oder auch die Unsicherheit eines narzisstischen Charakters, muss jeder für sich entscheiden – unterhaltsamen Stoff für beide Interpretationen liefert der Philosoph dem geneigten Publikum jedenfalls fast täglich.
Das größte Manko des Buches ist, dass dem Leser, der mit den angeblichen Vor- und Fehlurteilen gegenüber „der Postmoderne“ auf den ersten Seiten angetriggert wurde, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der aktuellen Kritik an postmodernem Denken vorenthalten wird. Diese erklärt Zorn pauschal für zu oberflächlich und ihre Vertreter letztlich für nicht satisfaktionsfähig, weshalb er nirgendwo im Buch auf sie eingeht.
Da es Zorn andererseits nicht gelingt, den positiven Beitrag der Postmoderne zum philosophischen Denken und zur politischen Praxis überzeugend auszuformulieren und stark zu machen, überlässt er das Feld notwendigerweise denjenigen, die die negativen Implikationen in ihrer Wirkungsgeschichte suchen und finden.
Diese Kritik schlägt – mit einem Abstand von vierzig Jahren und nicht nur von fünf – eine plausible Genealogie der Merkwürdigkeiten der „angewandten Postmoderne“ vor, deren aktuelle Vertreter ganz genau wissen…
„…that all white people are racist, all men are sexist, racism and sexism are systems that can exist and oppress absent even a single person with racist or sexist intentions or beliefs (in the usual sense of the terms), sex is not biological and exists on a spectrum, language can be literal violence, denial of gender identity is killing people, the wish to remedy disability and obesity is hateful, and everything needs to be decolonized“
… wie es Helen Pluckrose und James Lindsay in Cynical Theories so plakativ zusammenfassen.
Ich hätte schon ganz gerne gewusst, warum es falsch sein soll, identitätspolitische Aktivisten der heutigen Zeit ernst zu nehmen, wenn sie ihre Ideen auf Foucault und Co. zurückführen – zumal Zorn selbst einige dieser Positionen zu teilen scheint. Vielleicht ist es ja unter seiner Würde, sich mit einer so unterkomplexen und wenig formal-akademischen Version einer Ideengeschichte auseinanderzusetzen, wie sie uns von Pluckrose und Lindsay angeboten wird – aber es gäbe mit Alan Sokal, Paul Boghossian oder auch Markus Gabriel durchaus ernstzunehmende Alternativen, die ins gleiche Horn blasen.
Fazit: Aus Respekt vor der Komplexität postmodernen Denkens verweigert Zorn sich und uns ein abschließendes Urteil – und verweigert uns damit gleichzeitig eine argumentative Auseinandersetzung mit den wichtigsten Vorwürfen, die diesem Denken gemacht werden. Seinem Job als akademischen Philosophen wird er damit vielleicht gerecht, nicht aber seinem Job als Autor eines im besten Sinne populärphilosophischen Buches.
Denn die Weigerung Zorns, die Postmoderne auf den Punkt zu bringen, um sie weniger angreifbar zu machen, macht sie dadurch gleichzeitig weniger greifbar – und damit weniger begreifbar. Tragischerweise scheitert er letztlich selbst mit dieser Weigerung, wie seine fast schon geschichtsphilosophische Charakterisierung der Postmoderne als „Versuch, dem Absoluten zu entkommen“, zeigt.
Man kann Metaerzählungen offenbar nicht vermeiden, wenn man unterstellt, dass philosophische Inhalte jenseits akademischer Diskussionen irgendeine Relevanz für die Gesellschaft entfalten sollen. Metaerzählungen sind wohl das Medium, in dem ein solcher Relevanztest stattfindet – oder er findet eben nicht statt. Das kann man beklagen, aber man kann diesem Mechanismus nicht ausweichen – wie Zorn mit seinem eigenen Buch performativ belegt.
Der letzte Absatz seines Buches beginnt mit den Sätzen: „Die philosophische Postmoderne ist, so verstanden, einfach Philosophie. Sie ist die Reflexion der Moderne, das Ausloten ihrer Tiefen und Untiefen, der Versuch, dem Absoluten zu entkommen. In dieser Hinsicht ist sie gescheitert…“
Zorn vorzuwerfen, dass sein Versuch einer Ehrenrettung der Postmoderne gescheitert ist, wäre vermutlich genauso unfair wie sich darüber zu beklagen, dass man einen Pudding nicht an die Wand nageln kann. Es liegt wohl in der Natur des Gegenstandes, dass er nach diesem Versuch noch genauso amorph und unstrukturiert ist wie vorher. Nur noch weniger genießbar.